Wenn man sich über Erziehung informieren möchte, kommt man um die Begriffe “Bedürfnisorientierte Erziehung” oder “Gentle Parenting” mittlerweile nicht mehr herum. Aber worum handelt es sich eigentlich dabei?
In diesem Artikel erfahren Sie…
… Was Bedürfnisorientierte Erziehung ist
… Wie man Bedürfnisorientierte Erziehung umsetzt
… Welche Kritik es zu diesem Ansatz gibt
1.1 Definition
Bedürfnisorientierte Erziehung (auch Attachment Parenting, Bindungsorientierte Erziehung oder Gentle Parenting genannt) ist ein pädagogischer Ansatz, bei dem die individuellen Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt stehen. Ziel ist es, eine sichere Beziehung aufzubauen und es dem Kind zu ermöglichen, sich zu einem selbstständigen und selbstbewussten Menschen zu entwickeln.

Dabei wird aber nicht nur auf die Bedürfnisse des Kindes geachtet, sondern auf die der gesamten Familie. Die Bedürfnisse aller Familienmitglieder werden hierbei als gleichwertig angesehen.
Im Gegensatz zum autoritären Erziehungsstil, der mit Hierarchie, strengen Regeln und Bestrafungen arbeitet, wird bei bedürfnisorientierter Erziehung versucht, die Bedürfnisse aller Beteiligten in Einklang zu bringen und das Kind somit durch einen respektvollen Umgang, Empathie und Kommunikation auf Augenhöhe zu erziehen.
1.2 Grundprinzipien
Um eine sichere Beziehung zum Kind aufzubauen, gibt es einige Grundprinzipien der Bedürfnisorientierten Erziehung.
Darunter fallen:
- Bedürfnisse statt Verhalten im Fokus – Man reagiert nicht auf das Verhalten des Kindes, sondern hinterfragt dies auf die dahinterliegenden Bedürfnisse
- Verzicht auf Strafe und Manipulation – stattdessen wird auf respektvolle Kommunikation und gemeinsame Grenz- und Regelsetzung gesetzt
- Bindung und Beziehung – Vertrauen, Bindung und Zuwendung zum Kind stehen im Fokus
- Empathie und Kommunikation – Versuchen sich in das Kind hineinzuversetzen und dessen Gefühle zu verstehen und mit ihm darüber zu reden – ohne Vorurteile und auf Augenhöhe
1.3 Checkliste für bedürfnisorientiertes Handeln
In konkreten Alltagssituationen bedürfnisorientiert zu Handeln kann teilweise sehr kompliziert sein, wenn man nicht weiß wie man vorgehen soll.
Diese 6- Punkte Checkliste kann Ihnen dabei helfen:

- Was passiert gerade
- Was macht das Kind?
- Keine Bewertung
- Was könnte das Kind gerade brauchen (nicht wollen!)
- Emotion = Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses
- Dem Kind Verständnis zeigen – ohne zu korrigieren.
→ schafft Sicherheit & Beziehung
- Grenze oder Regel setzen (wenn nötig)
- Helfen Sie dem Kind aus dem Gefühl herauszufinden oder mitzugestalten
- Was war schwierig?
- Was sollte das nächste Mal anders gemacht werden?

1.4 Allgemeine Beispiele
Die Anwendung im Alltag könnte beispielsweise so aussehen:
Szenario: Kind möchte Gummibärchen im Supermarkt haben, Eltern sagen nein. Daraufhin wirft es sich auf den Boden und schreit.
- Die Situation neutral beschreiben: Das Kind hat einen Wutanfall
- Das dahinterliegende Bedürfnis erkennen: Das Kind möchte eine Belohnung/Selbstbestimmt handeln → Bedürfnis nach Genuss/Autonomie
- Gefühl & Bedürfnis empathisch benennen: “Du bist wütend weil du die Gummibärchen jetzt haben willst, das ist okay” → Empathie zeigen
- Klar & verantwortungsvoll Handeln: “Heute gibt es aber keine Süßigkeiten” → Grenze konsequent setzen
- Alternativen & Lösungen anbieten: Wenn du willst, können wir die Gummibärchen am Wochenende kaufen → Lösung anbieten
- Gemeinsam oder still reflektieren: “War es heute schwer für dich im Laden?” → Gemeinsame Reflexion zuhause
Szenario: Kind wird in der Kita abgegeben, weil die Eltern arbeiten müssen. Das Kind jedoch möchte die Eltern nicht loslassen und beginnt zu weinen.
- Die Situation neutral beschreiben: Das Kind weint, weil wir es im Kindergarten zurücklassen
- Das dahinterliegende Bedürfnis erkennen: Bedürfnis nach Sicherheit & Bindung
- Gefühl & Bedürfnis empathisch benennen: z.B.: „Du bist traurig, weil wir gehen und du hier bleiben musst, ich verstehe das.“
- Klar & verantwortungsvoll Handeln: Klar kommunizieren, dass man gehen muss und wieso, aber dennoch versuchen Trost zu spenden und Sicherheit zu geben
- Alternativen & Lösungen anbieten: Eine Vertrauensperson einbinden, z.B.: die Kindergärtnerin, um dem Kind jemanden an die Hand zu geben dem es Vertrauen kann & anbieten später Zeit mit dem Kind zu verbringen
- Gemeinsam oder still reflektieren: Kind später nach den Gefühlen in der Situation befragen oder selbst reflektieren was gut lief und was nicht.

2. Regelsetzung in Bedürfnisorientierter Erziehung
Eine Schwierigkeit und ein häufiges Missverständnis bei der Bedürfnisorientierten Erziehung ist Grenzsetzung. Wie oben schon erwähnt, sollte man auf Autorität und Strafe verzichten, aber dennoch nicht alles durchgehen lassen – Wie macht man das?
1. Regeln als Orientierung – nicht als Machtmittel
- Regeln sollen nicht einfach “von oben durchgesetzt” werden, sondern dem Kind Orientierung, Sicherheit und Mitbestimmung bieten.
- Man sollte reflektieren, wessen und welche Bedürfnisse diese Regel anspricht und ob sie wirklich nötig ist oder nur der Bequemlichkeit dient.
2. Regeln gemeinsam Entwickeln
- Kinder können (je nach Alter) bei der Gestaltung mitwirken – dadurch fühlt sich das Kind in Entscheidungen miteinbezogen und kann sie auch besser nachvollziehen, als wenn diese einfach ohne sie festgelegt werden.
3. Rahmen setzen mit Klarheit aber ohne Härte
- Konsequenzen statt Strafen – Dem Kind erklären, was durch ihr Fehlverhalten passieren kann oder passiert ist und wieso es schlecht ist.
- Verlässliche Regeln = Sicherheit – Regeln sollten fair, konsequent und nachvollziehbar sein. Wenn sie sich ständig ändern oder willkürlich wirken, kann Unsicherheit entstehen
- Regeln hinterfragen und anpassen – Kinder, Umgebung und Bedürfnisse ändern sich – was vor drei Jahren sinnvoll war, ist es jetzt vielleicht nicht mehr.
2.1 Beispiele Regelsetzung
Auch hier kann die Checkliste angewendet werden:
Regel: 2x am Tag Zähne putzen, Morgens und Abends
Szenario: Kind spielt gerade im Kinderzimmer, ein Elternteil ruft es zum Zähneputzen, doch das Kind weigert sich dies zu tun.
- Die Situation neutral beschreiben: Das Kind verweigert das Zähne putzen.
- Das dahinterliegende Bedürfnis erkennen: Autonomie oder Unlust
- Gefühl und Bedürfnis empathisch benennen: z.B.: „Ich verstehe du möchtest gerade nicht Zähne putzen, sondern lieber weiter spielen“
- Klar und verantwortungsvoll Handeln: z.B.: „Trotzdem müssen die Zähne geputzt werden“ –> Eventuell zusätzlich erklären wieso
- Alternativen & Lösungen anbieten: z.B.: „Wie wäre es wenn du dir Musik aussuchst, die wir währenddessen anhören“ –> Auch mit z.B.: Spielen, Farben o.ä. möglich
Regel: Nach dem Spielen muss aufgeräumt werden
Szenario: Das Kind spielt schon seit einer Weile, aber langsam wird es spät und es wird Zeit sich bald Bett fertig zu machen. Ein Elternteil fordert das Kind auf, die Spielsachen aufzuräumen, doch das Kind weigert sich.
- Die Situation neutral beschreiben: Das Kind weigert sich trotz Aufforderung das Zimmer aufzuräumen
- Das dahinterliegende Bedürfnis erkennen: z.B.: Autonomie, Unlust oder Spiel weiterführen wollen
- Gefühl & Bedürfnis empathisch benennen: Verständnis zeigen, dass das Kind momentan nicht aufräumen möchte
- Klar und verantwortungsvoll Handeln: z.B.: „Es muss aber aufgeräumt werden, damit du später alles wiederfindest und niemand über deine Spielzeuge stolpert und sich verletzt“
- Alternativen & Lösungen anbieten: Kind darf mitgestalten wie aufgeräumt wird, z.B.: Musik, spielerisch, wohin was kommt etc.
3. Bindungsorientierte Erziehung in den verschiedenen Entwicklungsphasen
Die Bedürfnisse des Kindes verändern sich je nach Alter und Lebensphase. Die Erziehung des Kindes sollte sich demnach daran anpassen und das Kind in dem Unterstützen, was es gerade braucht.
Orientieren können Sie sich an folgender Tabelle:
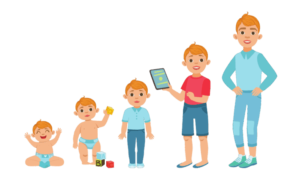
(0-1) Babyalter
Zentrale Bedürfnisse: Körperliche Nähe, Zuverlässige Reaktionen auf Weinen, Aufbau von Urvertrauen
Elternrolle: Hochgradig verfügbar & responsiv, Regulation der Gefühle des Kindes, Bindungspflege (statt Erziehung)
-> Basis für sichere Bindung schaffen
(1-3) Kleinkindalter
Zentrale Bedürfnisse: Nähe & Abgrenzung, Eigenständigkeit erproben, Emotionale Begleitung bei Frust & Wut
Elternrolle: Begleitende Führung, Co-Regulation = Gefühle benennen & Trost spenden, Bedürfnisse erkennen
-> Sicherheit durch Bindung + Freiraum zur Entwicklung
(3-6) Kindergartenalter
Zentrale Bedürfnisse: Zugehörigkeit zur Familie & Freundesgruppen, Orientierung durch Regeln, Selbstwertschätzung
Elternrolle: Verhandlungsbereiter Dialog, Erklärende Regeln, Vorbild sein
-> Selbstbewusstsein und Sozialverhalten entwickeln
(6-12) Schulkindalter
Zentrale Bedürfnisse: Anerkennung von Fähigkeiten, Struktur & Verlässlichkeit, Wachsende Selbstständigkeit
Elternrolle: Kooperative Eltern-Kind-Beziehung, Emotionale Begleitung bleibt wichtig, Fehler zulassen- lernen durch Erfahrungen
-> Selbstverantwortung fördern
(12+) Pubertät und Jugend
Zentrale Bedürfnisse: Abgrenzung von den Eltern, Selbstbestimmung, Meinung & Werte entwickeln, emotionale Rückversicherung
Elternrolle: Verlässlicher Rückhalt sein, Respektvoller Austausch statt Kontrolle, Vertrauen schenken, Interesse zeigen ohne sich aufzudrängen
-> Selbstständiger, reflektierter Mensch, der sich gebunden fühlt

4. Kritik an Bedürfnisorientierter Erziehung
Trotz des liebevollen und fürsorglichen Umgang miteinander, für den dieser Erziehungsstil steht, wurde auch für diesen Kritik hervorgebracht:
- Unklare Abgrenzung zwischen Bedürfnis und Wunsch– Eltern vermischen oft Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kinder und versuchen sofort jeden Wunsch zu erfüllen → Kann zu Verwöhnung des Kindes und Überforderung der Eltern führen
- Hoher Anspruch an die Eltern – Es kann sehr emotional und mental anstrengend für die Eltern sein, wenn sie ständig selbst reflektiert, verständnisvoll, empathisch sein müssen und nicht mit dem Kind schimpfen dürfen.
- Eltern geraten in den Hintergrund – Viele Eltern konzentrieren sich ausschließlich auf die Bedürfnisse und Probleme ihres Kindes und stellen sich dadurch selbst in den Hintergrund, was zu Dauerstress, Überlastung oder sogar Burnout führen kann.
- Grenzen werden zu weich gesetzt – Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Kinder teilweise ohne klare Grenzen aufwachsen, was dazu führt dass Kinder nicht lernen mit Frustration, Regeln oder Autorität umzugehen
- Gesellschaftliche Anschlussfähigkeit – In der Kita, Schule oder anderen öffentlichen Einrichtungen stoßen Kinder häufig auf gegenteilig wirkende, meist autoritäre Systeme → kann für Kinder und Eltern zu Konflikten führen
5. Zusammenfassung: Vorteile und Nachteile/ Herausforderungen
-> Man kann also zusammenfassend sagen, dass Bedürfnisorientierte Erziehung sehr viele emotionale und entwicklungspsychologische Vorteile mit sich bringt und sie das Kind und die Beziehung zu ihm nachhaltig stärkt.
Andererseits müssen Eltern lernen, mit dem hohen Anspruch umzugehen, richtig Grenzen zu setzen und dabei die eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen zu lassen.

